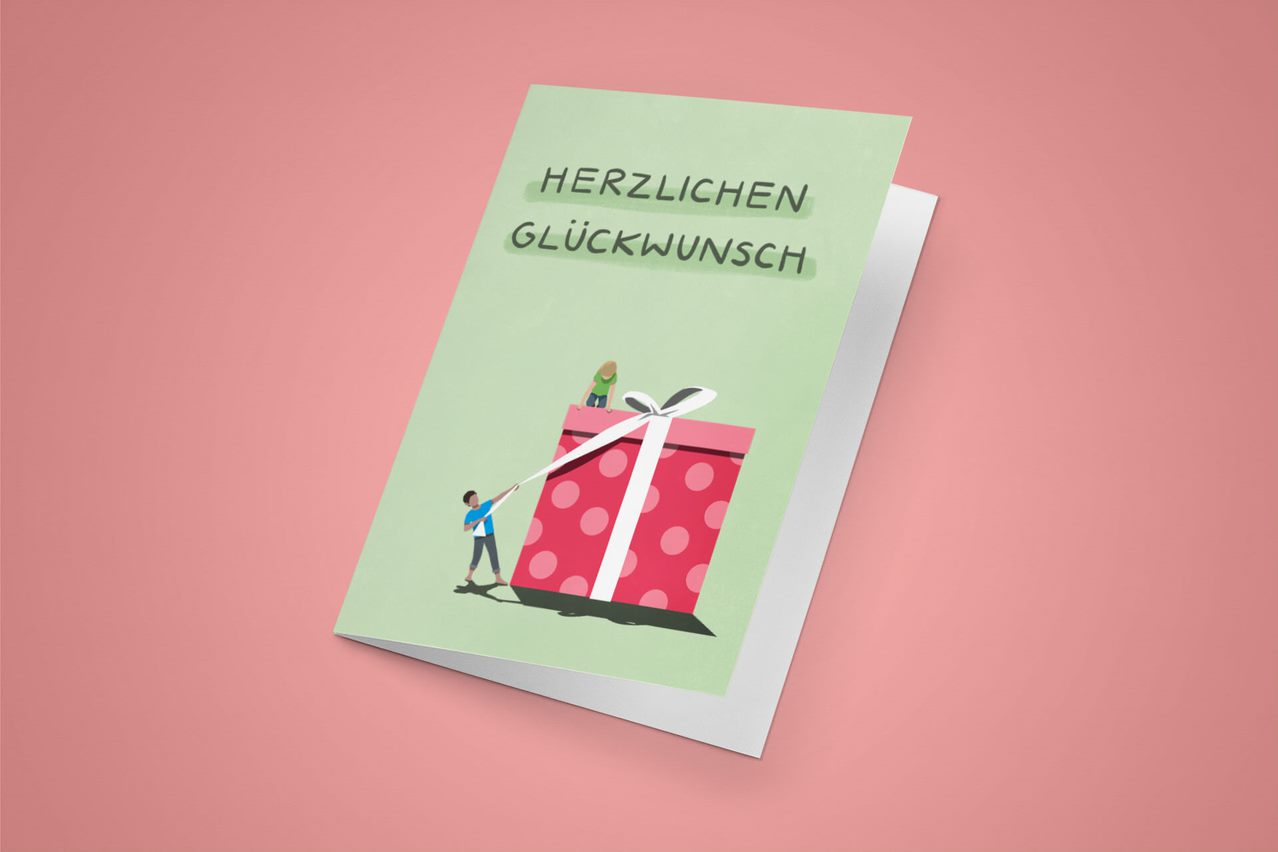Im Gespräch mit der Global Ombudsperson der SOS-Kinderdörfer
Wie kann Kinderschutz so gestaltet werden, dass Kinder und Jugendliche wirklich mitentscheiden? Und warum braucht es dazu neue Wege der Beteiligung und Beschwerdemechanismen? Wir haben mit Pierre Cazenave, dem Global Ombudsmann der SOS-Kinderdörfer, gesprochen. Er berichtet, warum die Prinzipien Unabhängigkeit, Vertraulichkeit und vor allem eine kindgerechte Herangehensweise zentrale Bausteine für wirksamen Kinderschutz sind.

Was genau macht eine „Global Ombudsperson“ bei SOS-Kinderdörfer?
Der Ombuds-Ansatz, den SOS-Kinderdörfer übernommen hat, ist zweigleisig. Die Mitgliedsorganisationen entscheiden, ob sie ein „organisationales Ombuds-Modell“ oder ein „klassisches Ombuds-Modell“ umsetzen möchten. Während Letzteres im Wesentlichen eine formale Zusammenarbeit mit staatlichen Mechanismen vorsieht (z. B. dem Büro eines staatlichen Kinder-Ombudsmanns oder einer unabhängigen Menschen- und Kinderrechtskommission), wird Ersteres vom Ombuds-Büro für SOS-Kinderdörfer umgesetzt, in dem ich arbeite.
Wir erfüllen unsere Aufgaben unabhängig von der Föderation der SOS-Kinderdörfer oder einer ihrer angeschlossenen Organisationen. Die Föderation ist eine sehr komplexe Dachorganisation, die mehr als 130 unabhängige und autonome nationale Mitgliedsorganisationen weltweit vereint. Das Ombuds-Büro für SOS-Kinderdörfer spiegelt diese Struktur wider, indem es in den Ländern, die mit uns zusammenarbeiten möchten, einen nationalen Ombudsperson einsetzt. Jede nationale Ombudsperson wird – um die Unabhängigkeit auf nationaler Ebene zu schützen – direkt von einer Regional-Ombudsperson betreut.
In meiner Funktion als Global Ombudsperson leite und begleite ich fünf Regional-Ombudspersonen. Innerhalb des Mandats, das uns SOS-Kinderdörfer übertragen hat – und wie bei jeder sozialen Innovation – folgt die Entwicklung des Ombuds-Büros einem iterativen Ansatz: Wir entwerfen, testen und verfeinern laufend unsere Prozesse und Standards. Es ist ein Privileg, diese Arbeit gemeinsam mit nationalen und regionalen Ombudspersonen, Kolleg:innen von SOS-Kinderdörfer und vor allem mit Kindern und Jugendlichen voranzutreiben, die von Beginn an eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Ansatzes gespielt haben. Mehr als 1.500 Kinder und Jugendliche haben direkt am Modell mitgearbeitet, nehmen gleichberechtigt mit Erwachsenen an der Auswahl aller Ombudspersonen (auch meiner eigenen) teil und sind auf nationaler Ebene maßgeblich an der Umsetzung beteiligt. Damit wird Rechenschaft gegenüber Kindern auf ein Niveau gehoben, das in anderen Initiativen unerreicht ist. Nationale Ombudspersonen und der Ombuds-Ansatz werden außerdem direkt von Kindern und Jugendlichen selbst evaluiert.
Darüber hinaus erhalte ich Anfragen direkt von Kindern und Jugendlichen und unterstütze sie dabei, Lösungen für Situationen zu finden, die sie innerhalb von SOS-Kinderdörfer nicht zufriedenstellend geklärt sehen. Das ist ebenso bereichernd wie herausfordernd, da ich überwiegend mit grenzüberschreitenden oder besonders komplexen Anliegen konfrontiert bin.
Worin unterscheidet sich Ihre Rolle von anderen Beschwerdeinstanzen?
Sie ist grundlegend anders: Wie erwähnt folgt das Ombuds-Büro für SOS-Kinderdörfer einem „organisationalen Ombuds-Ansatz“, der auf vier Prinzipien beruht, von denen wir nicht abweichen dürfen: Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Informalität und Vertraulichkeit.
Das Ombuds-Büro ist weder ein Berufungsmechanismus noch darf es Prüfungen, Ermittlungen oder formale Überprüfungen von Handlungen, Unterlassungen oder Entscheidungen durchführen, die das Wohl oder die Sicherheit von Kindern gefährden könnten. Wir arbeiten informell und helfen Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, die ein Anliegen oder eine Sorge im Zusammenhang mit dem Wohl oder der Sicherheit eines Kindes haben, Lösungen zu finden – insbesondere dann, wenn formale Schutzmechanismen nicht ausreichen.
Was hat Sie persönlich motiviert, Ombudsperson zu werden?
Ich bin zutiefst überzeugt, dass – egal wie fortschrittlich, gut ausgestattet oder umfassend ein formales System ist – es immer Menschen geben wird, die „durch die Maschen fallen“. Diese Menschen (Kinder wie Erwachsene) sind oft unsichtbar und stehen vor einer Wand, wenn sie versuchen, mit schwierigen Umständen in einer besonders verletzlichen Lage zurechtzukommen.
In meiner gesamten Laufbahn habe ich mich darauf konzentriert, solche Lücken im System zu schließen, um verletzliche Kinder zu schützen (z. B. Kinder auf der Flucht oder Kinder, die diskriminierten Gemeinschaften angehören). Ich habe erlebt, wie wir Erwachsene Kindern oft nicht gerecht werden, weil wir die Welt aus einer erwachsenen-zentrierten Perspektive sehen und ihnen kaum Macht oder Mitbestimmung einräumen.
Als ich gelesen habe, dass SOS-Kinderdörfer ein informelles System aufbaut, das mit und für Kinder entwickelt wird und ausschließlich darauf abzielt, ihnen zuzuhören, habe ich keinen Moment gezögert. Bis heute bereue ich diese Entscheidung nicht
Mit welchen Herausforderungen sind Sie am häufigsten konfrontiert?
Eine unserer größten Herausforderungen ist es, Fachleuten – die an formale Verfahren gewöhnt sind – zu erklären, wie wir unsere Arbeit durch informelle Interventionen leisten. Wir wissen, dass Verwaltungen gerne Papierdokumente mögen – und wir als Fachleute eigentlich auch. In unserer täglichen Ombuds-Arbeit versuchen wir jedoch, schriftliche Kommunikation so weit wie möglich zu vermeiden und mündliche Gespräche zu bevorzugen. Das steht oft im Widerspruch zu Organisationskulturen, die stark formalisiert sind.
Gibt es einen Fall (ohne Details), der Sie besonders bewegt hat?
Alle Kinder und Jugendlichen bringen ihre eigene Geschichte und Perspektive mit – und sie berühren uns immer. Besonders herausfordernd sind für uns Anfragen von Kindern, die versucht haben, sich das Leben zu nehmen oder die mit Suizidgedanken zu uns kommen.
Wie stellen Sie sicher, dass Kinder und Mitarbeitende sich sicher fühlen, ihre Stimme zu erheben?
Mit Zeit. Wir brauchen Zeit, um Vertrauen aufzubauen, und wir müssen zeigen, dass wir vertrauenswürdig sind. Kinder und Jugendliche haben keinen Grund, uns von vornherein zu vertrauen. Deshalb arbeiten wir mit jeder Mitgliedsorganisation im ersten Jahr intensiv daran, regelmäßig alle betreuten Kinder und Jugendlichen zu treffen. Besonders schwierig ist dies im Rahmen unserer Familienstärkungsprogramme.
Zudem beobachten viele interne und externe Stakeholder aufmerksam, wie sich unser Ansatz entwickelt. Wir müssen bei jedem Schritt sehr sorgfältig sein und Fehler vermeiden, da diese gravierende Auswirkungen auf die Wahrnehmung unserer Arbeit haben könnten. Und Wahrnehmung ist für uns entscheidend!
Wie stellen Sie die Unabhängigkeit der Ombudspersonen sicher?
Durch unser Ombuds Board, das aus sieben erfahrenen Fachleuten mit Ombuds-Hintergrund und/oder Expertise in Kinderschutz besteht, die alle unabhängig von SOS-Kinderdörfer sind. Dieses Ombuds Board kann man als Hüter unserer Unabhängigkeit an der Spitze eines pyramidenförmigen Governance-Modells bezeichnen. Wir Ombudspersonen berichten an dieses Board – und nicht an die Führungsebene von SOS-Kinderdörfer, weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene.
Wie trägt Ihre Arbeit zur Organisationsentwicklung im Kinderschutz bei?
Durch sogenanntes „Upward Feedback“: Wir geben so viel Rückmeldung wie möglich an die Organisation, indem wir Beobachtungen aus unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf individueller und organisatorischer Ebene weitergeben. Damit bieten wir nicht nur unseren engagierten Kinderschutz-Kolleg:innen, sondern auch Programmverantwortlichen „eine weitere Perspektive“.
Dafür haben wir besondere Austauschformate mit der Leitung geschaffen, z. B. vierteljährliche Treffen, in denen wir informell Einblicke in unsere Arbeit geben und Beobachtungen weitergeben – selbstverständlich ohne unsere Prinzipien (wie Vertraulichkeit) zu verletzen. Ob und wie diese Rückmeldungen genutzt werden, liegt bei der Leitung; wir machen keine formalen Empfehlungen und treten nicht als Interessenvertretung auf.
Was motiviert Sie jeden Tag?
Die Tatsache, dass in jedem Land, in dem es seit mindestens einem Jahr eine nationale Ombudsperson gibt, die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die unsere Dienste nutzen, stetig steigt. Das zeigt uns, dass Vertrauen aufgebaut wird und dass unsere Arbeit von den Kindern und Jugendlichen selbst als wertvoll empfunden wird.
Wie schaffen Sie es, trotz so belastender Themen in Balance zu bleiben?
Wenn der Druck steigt und sich die Welt um uns herum immer schneller zu drehen scheint, tue ich einfach das Gegenteil: ich werde langsamer.
Welche Werte sind Ihnen in Ihrer Rolle am wichtigsten?
Mut und Integrität.
Mehr zum Global Ombudssystem der SOS-Kinderdörfer finden Sie auf der englischsprachigen Webseite von SOS-Kinderdörfer International.