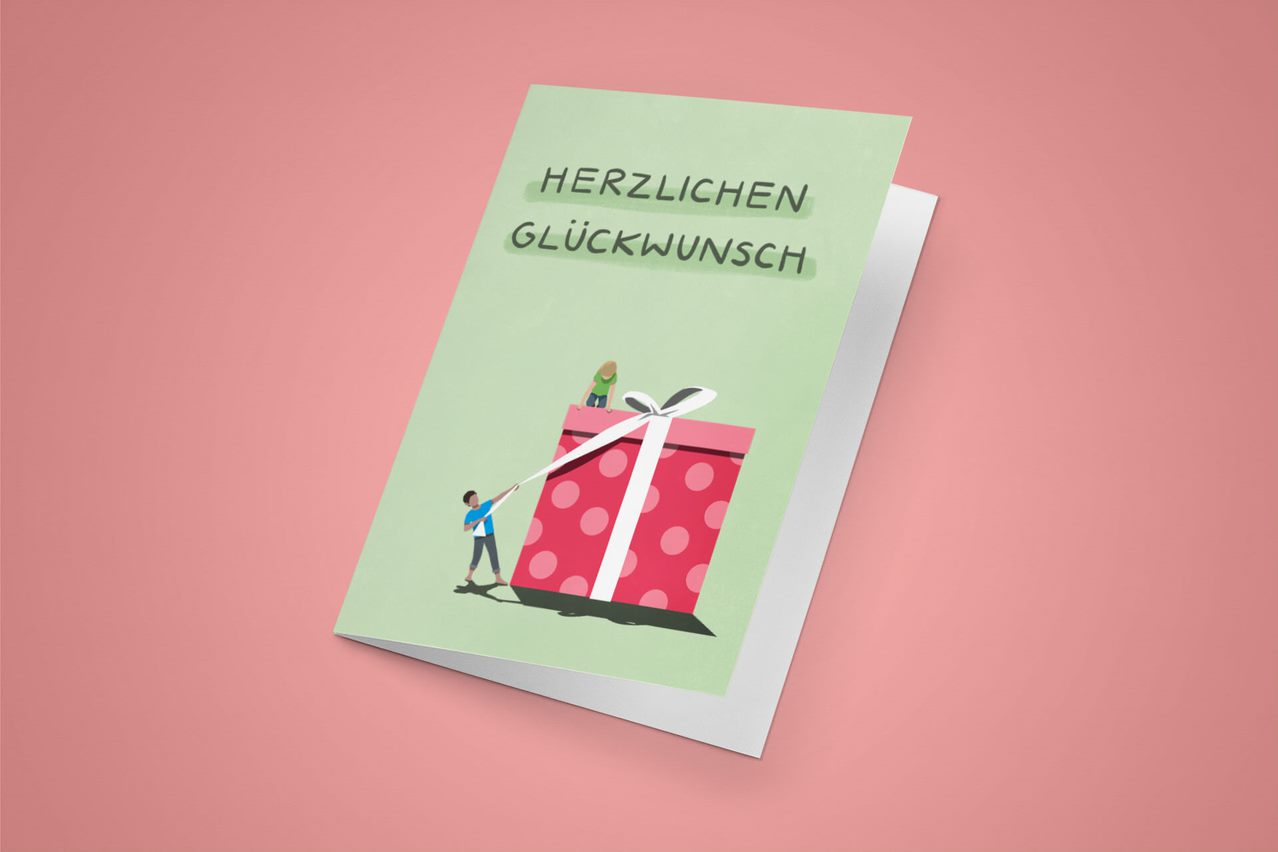Lautstark für die Werte der Vielfalt
Die Sozialarbeiterin Maricruz Granados koordiniert die länderübergreifenden Richtlinien zur Betreuung von LGBTQIA+ Kindern in den SOS-Kinderdörfern in Lateinamerika. Als Genderbeauftragte macht sie sich stark für das körperliche und psychische Wohlergehen der Kinder. Im Interview erzählte sie uns von LGBTQIA+ Erfolgsgeschichten und den schwerwiegenden politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen in der Region.

Frau Granados, viele lateinamerikanische Länder sind immer noch von traditionellen Rollenbildern und Machismo geprägt. Wie geht es LGBTQIA+ Personen in diesem Umfeld?
LGBTQIA+ Personen sind mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Oft werden sie von ihren Familien verstoßen und der Zugang zu Bildung und Ausbildung wird ihnen erschwert. Sie erhalten nur eine marginale Gesundheitsversorgung und keine psychologische Hilfe in Bezug auf ihre Geschlechtsidentität und Sexualität. Je nach Gesetzgebung werden Beziehungen zwischen LGBTQIA+ Menschen in einigen Ländern kriminalisiert. Die Isolation und Diskriminierung innerhalb der Familie, in der Schule und in der Gemeinde führen bei ihnen häufig zu Depressionen und anderen gesundheitlichen Problemen. Viele sehen sich aus Angst zur Flucht gezwungen.
"LGBTQIA+ Personen sind mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Oft werden sie von ihren Familien verstoßen und der Zugang zu Bildung und Ausbildung wird ihnen erschwert."
Wohin fliehen sie?
Es gab zum Beispiel eine große Gruppe von Betroffenen aus Nicaragua, El Salvador und Guatemala, die in die Vereinigten Staaten auswandern wollte. Viele von ihnen wurden von kriminellen Banden verfolgt. Sie fürchteten um ihr Leben - wegen ihrer Geschlechtsidentität und Sexualität. Einige Transmädchen unter den Geflüchteten wurden von den SOS-Kinderdörfern in Mexiko aufgenommen.
Wie viele LGBTQIA+ Jugendliche gibt es in den lateinamerikanischen SOS-Kinderdörfern?
Das ist schwer erfassbar. Ihr Anteil dürfte in etwa dem Bevölkerungsdurchschnitt des jeweiligen Landes entsprechen. Die Zahl könnte aber auch höher sein, da in einigen Ländern LGBTQIA+ Kinder überdurchschnittlich häufig in Pflegefamilien oder auf der Straße leben. Zudem wagen Jugendliche oft nicht, ihre sexuelle Identität zu offenbaren, etwa wenn Homosexualität in ihrem Land strafbar ist.
Wie unterstützen Sie die Jugendlichen?
Am wichtigsten ist, dass wir unseren unerschütterlichen Glauben an die Werte der Vielfalt klar und lautstark kommunizieren – gegenüber staatlichen Behörden und den Gemeinden. Die LGBTQIA+ Jugendlichen sollen wissen, dass unsere Einrichtungen LGBTQIA+ freundliche Orte sind, dass sie sich hier sicher fühlen können. Auch für unsere Mitarbeitenden ist diese klare Kommunikation ganz wichtig, oft bestehen Unsicherheiten. Sie rühren unter anderem daher, dass die meisten von uns mit diesen macho-patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen aufgewachsen sind. Deshalb haben wir Leitlinien entwickelt, die auf dem Recht von Gleichberechtigung und Antidiskriminierung basieren.
"Am wichtigsten ist, dass wir unseren unerschütterlichen Glauben an die Werte der Vielfalt klar und lautstark kommunizieren – gegenüber staatlichen Behörden und den Gemeinden."
In Ländern wie Haiti oder Jamaika wird Homosexualität immer noch als Verbrechen geahndet. Wie gehen Sie dort vor?
Unser Ziel ist es, Politikern und Politikerinnen, sowie Mitarbeitenden der jeweiligen Regierungen bewusst zu machen, dass Sexualität ein wesentlicher Bestandteil der Identität eines Menschen ist – auch, und gerade dann, wenn sie nicht mit den vorherrschenden Gesellschaftsstrukturen konform geht.

Wie unterstützen Sie die Kinder in der freien Entfaltung ihrer Geschlechtsidentität und sexuellen Orientierung sonst noch?
Wir tragen Sorge für ihre psychische Gesundheit und ihr körperliches Wohlbefinden, und wir streben eine umfassende Sexualerziehung für alle Kinder und Jugendlichen in unserer Betreuung an. Auch die Sensibilisierung der Gemeinden ist bedeutsam. Vor allem aber müssen die Kinder Zugang haben zu wissenschaftlichen Informationen über ihre Geschlechtsidentität und zu Gesundheitsleistungen wie Verhütungsmitteln oder Hormonbehandlungen. Und wir müssen ihre politische Teilhabe fördern.
Wie fördern Sie die Teilhabe?
Wir erarbeiten zum Beispiel gerade zusammen mit LGBTQIA+ Jugendlichen aus Ecuador, Peru, Guatemala und Venezuela eine Graphic Novel über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Für die Story entwickeln die jungen Leute auf Grundlage ihrer eigenen persönlichen Erfahrungen lesbische, schwule und transsexuelle Charaktere.
Welche Rolle schreiben Sie den sozialen Medien zu – sensibilisieren sie die Menschen für sexuelle Vielfalt oder sind sie eher kontraproduktiv?
Soziale Medien sind ein mächtiges Werkzeug, ein super Multiplikator, um die Lebensrealitäten der LGBTQIA+ Gruppe aufzuzeigen. Wir befürworten, dass LGBTQIA+ Jugendliche aus unseren Programmen auf Social Media über sich erzählen. Genau darum geht es: ihnen eine Stimme zu geben. Die Möglichkeit, Sichtbarkeit zu schaffen, ist dank Social Media viel größer als früher. Natürlich sind damit auch Risiken verbunden. Es kann zu Hass-Kommentaren und zu Diskriminierung kommen. Deshalb finde ich das YouTube-Video von Mael unglaublich mutig, einem Transjunge, der im mexikanischen SOS-Kinderdorf Morelia aufgewachsen ist.
Erzählen Sie!
In dem YouTube-Video erzählt er, dass er als Mädchen geboren wurde, aber immer spürte, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Mit 16 Jahren hat er sich seiner SOS-Kinderdorf-Mutter anvertraut, die sich mit dem ganzen Team des SOS-Kinderdorfs beriet, und dann haben alle Mael bei seiner Transition unterstützt. Heute ist er 20 Jahre alt, seine Transition ist abgeschlossen. Trotzdem erfährt er noch Diskriminierung, zum Beispiel wird er noch oft mit seinem Mädchennamen angesprochen. Es hat wirklich Mut erfordert, seine Geschichte öffentlich zu erzählen. Innerhalb der lateinamerikanischen LGBTQIA+-Gruppe werden Transpersonen am meisten diskriminiert, sie verlieren am häufigsten die familiäre Fürsorge, vor allem, wenn sie als Jungen geboren wurden und die Transition zum Mädchen machen.
"Innerhalb der lateinamerikanischen LGBTQIA+-Gruppe werden Transpersonen am meisten diskriminiert, sie verlieren am häufigsten die familiäre Fürsorge, vor allem, wenn sie als Jungen geboren wurden und die Transition zum Mädchen machen."
Wie kommt das?
Das hat mit den patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen zu tun. Die Menschen nehmen es Transmädchen übel, dass sie die sozialen Privilegien, die mit dem Mannsein einhergehen, ,nicht zu schätzen wissen‘. Sie werden auch von den Gesundheitsdiensten stigmatisiert, indem ihnen zum Beispiel Hormonbehandlungen verweigert werden. Oft sind sie Gewalt ausgesetzt. In ihrer Not verdingen sich viele als Sexarbeiterinnen, viele sind wohnungslos.
Einer US-amerikanischen Studie zufolge sinkt die Akzeptanz gegenüber LGBTQIA+ Personen, je mehr die Religion im Alltag der Menschen eine Rolle spielt. Inwiefern gilt das für Lateinamerika?
Lateinamerika ist eine sehr religiöse Region. Zudem ist ein Vormarsch von finanzstarken, und damit einflussreichen, religiösen Gruppen zu beobachten. Dazu kommen Gruppierungen, die ich schlicht als ,Menschenrechtsgegner:innen‘ bezeichnen würde. Die beiden Lager schließen sich zunehmend zusammen und unterwandern die Exekutive der Länder. Sie versuchen, politische Reformen zu Fall zu bringen, die etwa die gleichgeschlechtliche Ehe oder das Recht auf Abtreibung anerkennen. Das finde ich sehr beunruhigend. Möglicherweise können wir die Fortschritte nicht aufrechterhalten, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Auch in Bezug auf die Finanzierung unserer Programme ist die Situation nicht unproblematisch.
Inwiefern?
Bei der Betreuung von Kindern verfolgen wir ja einen familienorientierten Ansatz, der der Haltung unserer Spenderinnen und Spender erstmal entspricht. Wenn wir uns aber zu den Rechten von LGBTQIA+ Personen oder zum Recht auf Abtreibung positionieren, laufen wir Gefahr, Unterstützung und Partnerschaften zu verlieren. Deshalb versuchen wir, aufzuklären und Ängste zu nehmen: Es gibt viele gute Gründe für Vielfalt.