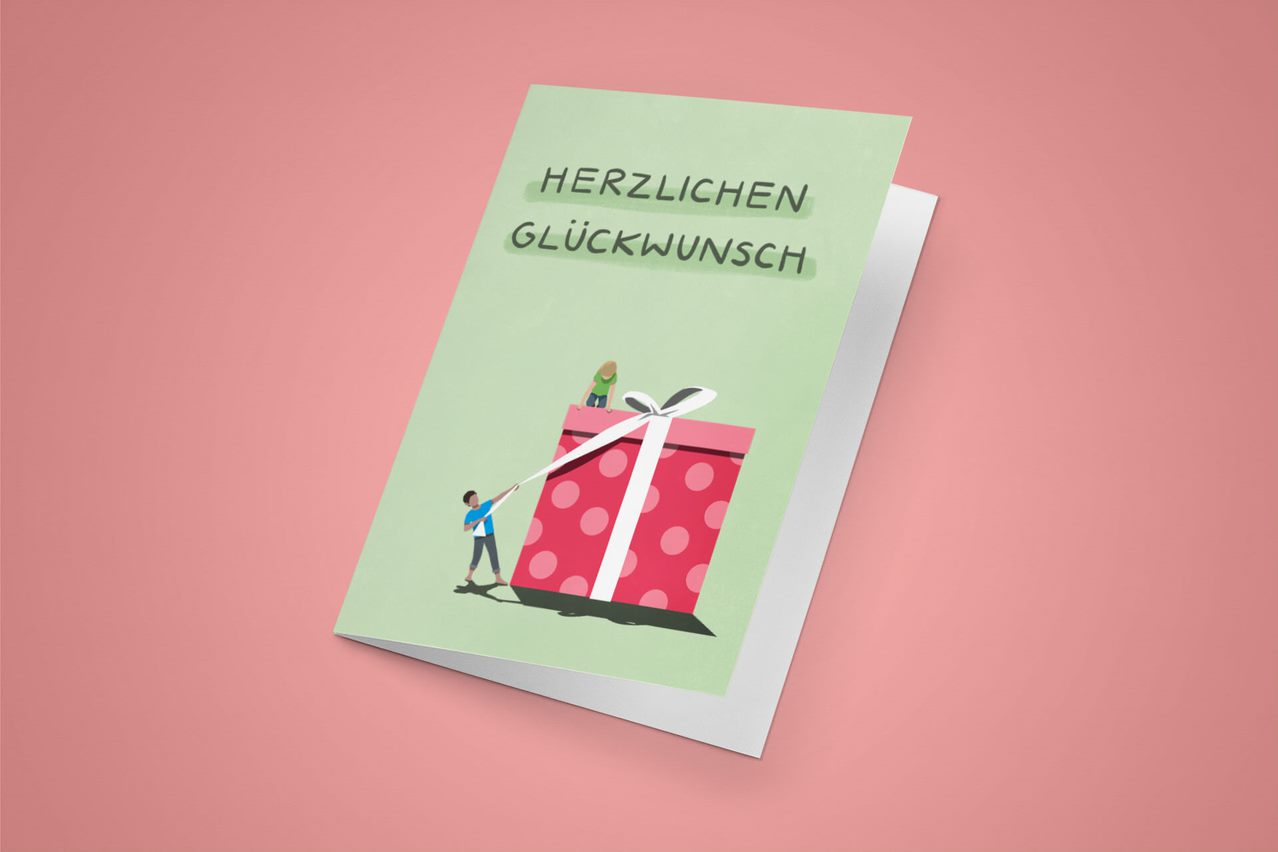Auf der Flucht: So viele Menschen wie nie zuvor
Flucht, Vertreibung, Migration: Ursachen, aktuelle Zahlen und Fakten
Sie fliehen vor Kriegen und Konflikten: Mehr als 122 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, so viele Menschen wie nie zuvor. Vier von zehn Geflüchteten und Vertriebenen sind Kinder und Jugendliche. Immer mehr Menschen verlassen auch wegen den Folgen der Klimakrise ihr Zuhause.
Millionen Menschen auf der Flucht
Ende 2024 waren laut dem aktuellen Global Trends-Report vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) 123,2 Millionen Menschen auf der Flucht. Das entspricht einem Anstieg von 6 Prozent im Vergleich zum Jahresende 2023. Während sich die Zahl der Vertriebenen weltweit in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt hat, verlangsamte sich die Zuwachsrate in der zweiten Hälfte des Jahres 2024. Ende April 2025 ist die Zahl auf weltweit 122,1 Millionen Menschen gesunken.
Ob dieser leichte Abwärtstrend im Jahr 2025 weiter anhält, wird unter anderem davon beeinflusst, ob Frieden erreicht werden kann oder zumindest die Kämpfe enden – vor allem in der Demokratischen Republik Kongo, im Sudan und in der Ukraine. Zudem bleibt abzuwarten, wie stark die aktuell starken Mittelkürzungen im humanitären Sektor – etwa bei USAID – die Fähigkeit beeinträchtigen, weltweit Vertreibungskrisen zu bewältigen und Geflüchteten eine sichere Rückkehr zu ermöglichen.

Die größten Vertreibungskrisen
Der Bürgerkrieg im Sudan stellt aktuell die größte Vertreibungskrise der Welt dar. Insgesamt gab es dort Ende 2024 laut UNHCR 14,3 Millionen Vertriebene – fast jeder Dritte im Land ist betroffen. In Syrien waren Ende 2024 immer noch 13,5 Millionen Menschen innerhalb und außerhalb des Landes auf der Flucht. In Afghanistan waren es 10,3 Millionen und in der Ukraine 8,8 Millionen Menschen.
Die Mehrheit ist auf der Flucht im eigenen Land
Die meisten Menschen, die auf der Suche nach Schutz und Sicherheit ihr Zuhause verlassen, überschreiten keine Landesgrenze: Sie sind als sogenannte "Binnenvertriebene" in ihrem Heimatland auf der Flucht. Sie machen rund 60 Prozent aller gewaltsam Vertriebenen aus. Das Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) erhebt Zahlen zur Binnenflucht: Nach dem neusten Bericht vom Mai 2025 lebten bis Ende des Jahres 2024 weltweit 83,4 Millionen Menschen als Binnenvertriebene, das ist ein neuer Höchstwert, das sind mehr als doppelt so viele Menschen wie noch vor sechs Jahren. Fast 90 Prozent der Binnenvertriebenen flohen wegen Konflikten und Gewalt. Allein 11,6 Millionen Binnenvertriebene leben derzeit im Sudan, das ist die höchste Zahl, die ein einzelnes Land jemals verzeichnet hat. Ende 2024 war außerdem fast die gesamte Bevölkerung Gazas weiterhin vertrieben. Auch in der Demokratischen Republik Kongo musste besonders viele Menschen fliehen.
Stark angestiegen ist die Anzahl der Menschen, die durch Katastrophen vertrieben wurden - 9,8 Millionen gab es Ende 2024, das sind fast 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zyklone, wie die Hurrikane Helene und Milton in den USA und der Taifun Yagi in mehreren ostasiatischen Ländern verursachten mehr als die Hälfte der Vertreibungen durch Katastrophen. In allen Erdteilen zwangen Überschwemmungen die Menschen zur Flucht im eigenen Land, zum Beispiel in Brasilien, im Tschad, in Afghanistan oder auf den Philippinen. Bei der Zahl der Vertreibungen wird auch mitgezählt, wenn Menschen mehrmals fliehen mussten. So gab es alleine im Jahr 2024 45,8 Millionen Binnenvertreibungen aufgrund von Stürmen, Überschwemmungen oder anderer Katastrophen. Dazu gehören aber auch Evakuierungen, die vorbeugend vorgenommen wurden und somit vielen Menschen das Leben retteten.
Vier von zehn Geflüchteten sind Kinder
Obwohl Kinder weniger als 30 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, sind rund 40 Prozent aller Menschen auf der Flucht unter 18 Jahre. So meldet die International Data Alliance for Children on the Move (IDAC) bis Ende 2022 mehr als 47 Millionen Kinder, die in ihrer Heimat oder einem anderen Land auf der Flucht sind. Darunter waren allein vier Millionen Kinder aus dem Sudan und fast zwei Millionen aus der Ukraine. Kinder sind auf der Flucht besonderen Gefahren ausgesetzt. Sie haben ein erhöhtes Risiko, sexuelle Ausbeutung, Missbrauch und Gewalt zu erleben, besonders dann, wenn sie unbegleitet, also von ihren Eltern getrennt sind.




_936x624.jpg?width=936&height=624&ext=.jpg)