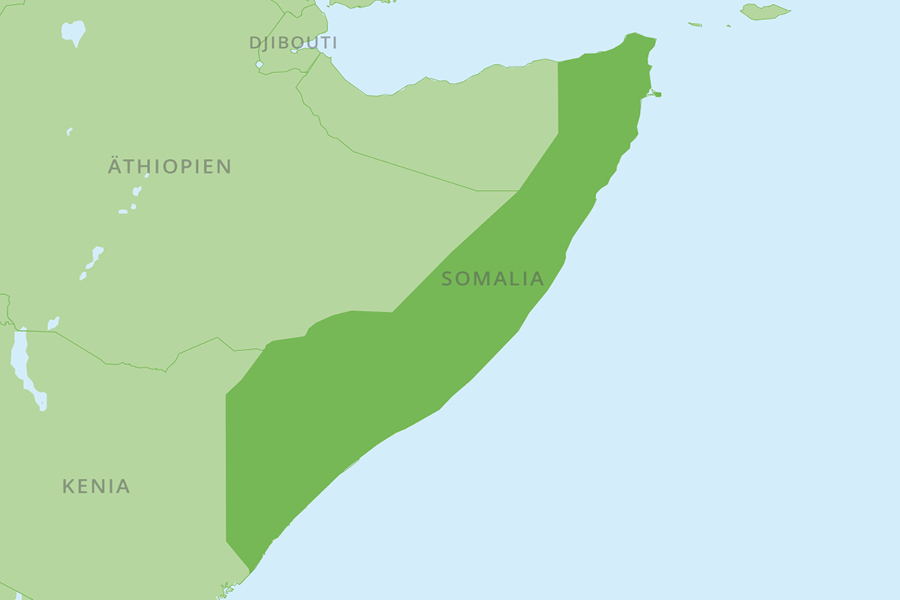Somalia: "Viele Kinder wollen später Krankenpfleger werden!"
SOS-Kinderdörfer weltweit ist eines der wenigen Hilfswerke, die seit den 80er Jahren ununterbrochen in Somalia aktiv sind. Die Organisation unterhält in der Hauptstadt Mogadischu ein Kinderdorf, eine Mutter-Kind-Klinik und eine Krankenschwesterschule, sowie einige Feldkliniken für die Opfer der Hungersnot. Ahmed Ibrahim, 42, ist der Somalia-Koordinator der Organisation. Er erzählt, wie Hilfe aussieht, wenn ringsum Schüsse fallen.
Süddeutsche Zeitung: In Ihrem Kinderdorf in Mogadischu leben 80 Kinder. Wie geht es ihnen und ihren Betreuern?
Ahmed Ibrahim: Am Dienstagabend mussten wir das Kinderdorf und die Klinik bis auf die Notbesatzung evakuieren. In unserem Stadtviertel wird heftig gekämpft. Es ist die Gegend neben der alten Nudelfabrik und dem Stadion, früher hatte die islamistische Shabaab-Miliz hier ihre wichtigsten Stützpunkte. Anfang des Monats haben sie sich zwar zurückgezogen, aber nur offiziell, denn einzelne Gruppen kämpfen weiter gegen die Regierungstruppen. Am Dienstag beschossen sie sich mit Mörsergranaten und Flugabwehrraketen – über unsere Köpfe hinweg. Einige Dächer bei uns nahmen Schaden, aber Gott sei Dank wurde niemand verletzt.
Wo sind die Kinder nun untergebracht?
Ibrahim: Im Afgoye-Korridor 13 Kilometer südlich von Mogadischu. Dort ist ein großes Lager für Binnenflüchtlinge. Ende des vergangenen Jahres haben wir dort fünf sehr schlichte Unterkünfte aus Blech gebaut, um auf solche Situationen vorbereitet zu sein. In diesen Blechhäusern wohnen nun jeweils zwei SOS-Familien mit sieben bis acht Kindern.
Um welche Kinder kümmern Sie sich?
Ibrahim: Es sind Kriegswaisen, der jüngste ist vier Monate alt. Viele Kinder haben wir 2007 aufgenommen, als die äthiopische Armee in Mogadischu gewütet hat. Ubah, ein sechsjähriges Mädchen und Faisal, ihr vierjähriger Bruder, verloren damals ihre beiden Eltern. Erst starb die Mutter, dann wurde der Vater auf der Straße erschossen. Die Kinder landeten bei ihrer Oma, die sehr alt war, sie konnte kaum noch sehen. Fast jeden Tag ging sie auf den Markt Holz verkaufen. Ihre Enkelkinder band sie mit einem Strick fest, da sie Angst hatte, sie könnten sonst auf die Straße laufen. Faisal und Ubah verbrachten so ganze Tage festgebunden im Dunkeln. Als uns ihre Nachbarn davon erzählten, überredeten wir die alte Frau, die Kinder zu uns zu bringen. Heute gehen beide bei uns zur Schule.
Wie sieht ihre Zukunft aus?
Ibrahim: Wenn sie weiterhin gute Noten haben, schicken wir sie auf unser Gymnasium in Somaliland (Autonomes Gebiet im Norden Somalias – Red.) Mit dem dortigen Abschluss könnten sie sogar im Ausland studieren. Jamad, ein Mädchen, das wir kurz vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs aufgenommen hatten, macht heute ihren Master in Australien. Viele Kinder, die nach der Schule bei uns bleiben, bilden wir zu Krankenpflegern aus.
Können die Kinder in Mogadischu überhaupt in Ruhe lernen?
Ibrahim: Geschossen wurde hier schon immer. Wir alle, ob groß oder klein, müssen mit der Angst leben, die nächste Kugel oder Granate könnte einen von uns treffen. Wer sich hier auf die Straße wagt, weiß nicht, ob er zurückkommt. Nun ist die Situation völlig unübersichtlich. Wir wissen nicht, wann die Kinder zurückkehren können, denn unser Stadtviertel ist jetzt Niemandsland. Die Übergangsregierung kann die Gegend nicht sichern, denn sie hat keine ordentliche Polizei. Wir haben 42 Wachmänner, aber sie sind unbewaffnet.
Warum nicht?
Ibrahim: Es bringt nichts. Früher hatten wir bewaffnete Sicherheitsleute, damals mussten wir uns gegen Banden schützen, die versuchten, unser Personal zu entführen. Aber als al-Shabaab kam, konnten sie bei uns rein und rausgehen, wie sie wollten. Gegen al-Shabaab kann man sich nicht mit Wachmännern wehren. Sie waren de facto Staatsgewalt, und sie könnten bald zurückkommen.
Die Miliz hat viele Hilfswerke verboten. Wie konnten die SOS-Kinderdörfer bestehen?
Ibrahim: Verboten wurden Organisationen, die sich öffentlich gegen al-Shabaab geäußert hatten, wie das Welternährungsprogramm (WFP), das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) oder World Vision. Wir sind seit 1985 im Land und immer unpolitisch geblieben. Wir behandeln in unseren Kliniken auch die Frauen und Kinder der Shabaab-Kämpfer. Deswegen haben sie unsere Konvois vom Flughafen zum Gelände immer durchgelassen. Sie haben auch selten gezielt auf uns geschossen. Unser Problem sind meistens Irrläufer bei Gefechten gewesen.
Im September 2006 wurde eine italienische Nonne getötet, die bei Ihnen arbeitete.
Ibrahim: Das war kein Irrläufer, sie wurde direkt vor unserem Krankenhaus niedergeschossen. Eigentlich war es nach der Ankunft der Islamisten ruhiger geworden, im Vergleich zum Chaos der neunziger Jahre. Auf dem Land, etwa in Baidoa, wo wir eine Feldklinik unterhalten, herrschen die Islamisten immer noch, und dort ist es sicherer als in Mogadischu. Seit dem Mord an der Nonne haben wir aber nur somalische Mitarbeiter. Vor vier Jahren verloren wir trotzdem zwei weitere Kollegen, beide somalische Krankenpfleger, beide Männer. Wir wissen immer noch nicht, wer sie hingerichtet hat.
Die meisten Mitarbeiter im Kinderdorf sind Frauen.
Ibrahim: Einige sind seit mehr als 20 Jahren dabei und immer noch zuversichtlich, dass dieser Bürgerkrieg irgendwann aufhört. Im Dezember 2007, als äthiopische Soldaten die Pastafabrik einnahmen, wurde eine unserer Erzieherinnen von einer Granate getötet. Die Menschen aus unserem Viertel flohen damals in andere Teile Mogadischus, denn hier hagelte es Bomben, wie heute. Wir vom Managementteam wussten nicht, wie wir all die Kinder in Sicherheit bringen sollen, denn die Unterkünfte im Afgoye-Korridor hatten wir noch nicht. Da haben unsere Erzieherinnen die Initiative ergriffen. Sie schmuggelten die Kinder einzeln heraus und brachten sie in angemieteten Häusern am anderen Ende der Stadt unter. Erst ein Jahr später konnten wir sie alle zurückholen.
Kümmern sie sich auch um Hunger-Waisen?
Ibrahim: Noch nicht, aber vielleicht nehmen wir bald welche auf. Es gibt Kinder ohne Eltern in den Flüchtlingslagern. Bei uns wird es ihnen wohl besser gehen. Für akut unterernährte Kinder, ob Waisen oder nicht, haben wir in den Lagern Kliniken eingerichtet. Wird ein Kind bei uns aus der Intensivpflege entlassen, geben wir den Verwandten Hochenergie-Nahrung wir Erdnusspaste mit auf den Weg. Oft werden diese Rationen leider unter allen hungrigen Familienmitgliedern aufgeteilt, dann bringen die Angehörigen die unterernährten Kinder wieder ins Krankenhaus. Deswegen haben wir die Rationen so erhöht, dass sich ganze Familien davon ernähren können.
Interview: Tim Neshitov, Süddeutsche Zeitung