Zuflucht für Straßenkinder
In Ruanda schlafen Straßenkinder im Freien, in Hauseingängen oder verlassenen Gebäuden. Ausbeutung, Schläge und Diskriminierung gehören zum Alltag. Im SOS-Kinderdorf in Kigali, der Hauptstadt, gibt es einen Schutzraum für Straßenkinder.
Wenn die Mittagssonne auf die Hügel von Kigali fällt, zieht sich Umwari, 13 Jahre alt, in einen Raum zurück, den man hier "Ihumure" nennt – Trost, Geborgenheit. Gemeinsam mit zwei anderen Mädchen, Cadette (9) und Rose (8), sucht sie Schutz vor einer Welt, die für sie lange alles andere als freundlich war. Die SOS-Kinderdörfer in Ruanda haben diese Räume eingerichtet: Rückzugsorte, ausgestattet mit buntem Spielzeug, leuchtenden Wänden und Bildschirmen, die nicht nur ablenken, sondern auch zum Spielen und Nachdenken einladen.
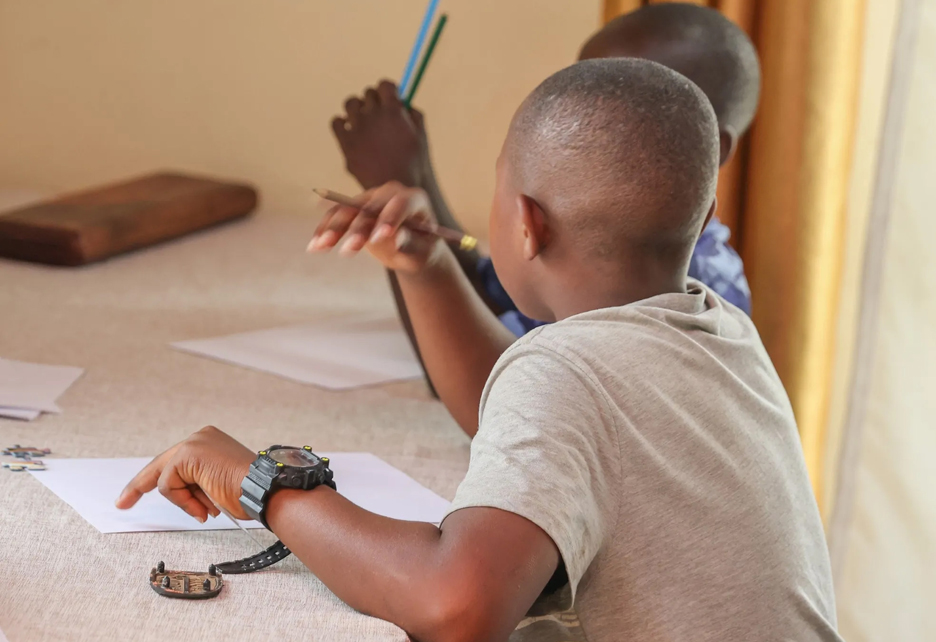
Hier, fernab von der Härte der Straße, werden die jungen Besucher:innen von Psychologinnen und Psychologen begleitet. Venantie Nyirambabazi ist eine von ihnen. Sie kennt die Geschichten hinter den Gesichtern – die Unsicherheiten, die Traumata, den Hunger nach einer Kindheit, wie andere sie erleben dürfen. "Unsere wichtigste Aufgabe ist es, zuzuhören", sagt sie. "Die Kinder sollen sich hier sicher fühlen. Es braucht Zeit, doch irgendwann beginnen sie, ihre Erlebnisse zu teilen."
Gewalt trieb Umwari auf die Straße
An diesem Nachmittag sind es zunächst nur Blicke, mit denen sich die drei Mädchen verständigen. Ihre Gesichter sind ernst, ihr Vertrauen tastend. Erst langsam öffnet sich Umwari. In sanften Worten erzählt sie von ihrer Mutter, von deren neuer Ehe und von Aufgaben, die für ein Kind zu groß waren: Waschen, Kochen, Putzen – und von der Gewalt, die sie schließlich aus dem Zuhause auf die Straße trieb. "Das war eine sehr schmerzhafte und schwierige Zeit in meinem Leben", sagt sie und Tränen rinnen ihr über die Wangen.
"Der Mann meiner Mutter hat mich oft geschlagen. Auf der Straße war das Leben härter, als ich es mir je vorgestellt hatte." Sie beschreibt Nächte voller Angst. "Man wird grundlos misshandelt, kann kaum schlafen, weil man ständig in Sorge ist, erneut Opfer von Gewalt zu werden. Es fühlt sich an wie in der Hölle." In diesen Momenten des Erzählens liegt der Beginn der Heilung.
Dass Kinder wie Umwari, Cadette und Rose heute in den SOS-Kinderdörfern eine neue Chance bekommen, ist nicht selbstverständlich. Die Organisation reagierte 2022 auf den sprunghaften Anstieg von Straßenkindern in Ruanda mit der Gründung der Ihumure-Häuser.
Ein Ort der Unterstützung und Hoffnung
In enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Gleichstellung und Familienförderung kümmern sich Teams darum, dass die Kinder nicht nur medizinisch versorgt werden, sondern auch maßgeschneiderte Lernpläne erhalten. "Wir unterstützen sie bei der Wiedereingliederung in den Schulalltag, helfen ihnen, Prüfungen vorzubereiten und sorgen dafür, dass sie in den richtigen Klassen unterkommen", erklärt Venantie Nyirambabazi.
Der Alltag in den Ihumure-Räumen ist geprägt von kleinen Fortschritten. Angélique Massengesho, eine der Betreuerinnen, betont die Bedeutung von Routine und Fürsorge: "Wir nehmen die Kinder als Teil unserer Familie auf. Der erste Schritt ist, dass sie ankommen dürfen – ohne Druck, ohne Fragen. Mit der Zeit geben wir ihnen Hilfestellung, wo sie sie brauchen. Jedes Kind soll spüren, dass es willkommen ist."
Partnerschaft für eine bessere Zukunft
Die Arbeit der SOS-Kinderdörfer geht über die bloße Versorgung hinaus: Ziel ist die Rückkehr ins Familienleben, sofern das möglich ist, und die Förderung eines selbstbestimmten Lebens. Die Zusammenarbeit mit der ruandischen Regierung schafft dafür die Voraussetzungen.
In den bunten Räumen von Ihumure lernen Umwari, Cadette und Rose, dass Geborgenheit möglich ist. Ihr Schweigen wird langsam von Lachen abgelöst, ihre Sorgen von Hoffnung – auf eine Zukunft jenseits der Straße.
* Namen wurden zum Schutz der Kinder geändert.


