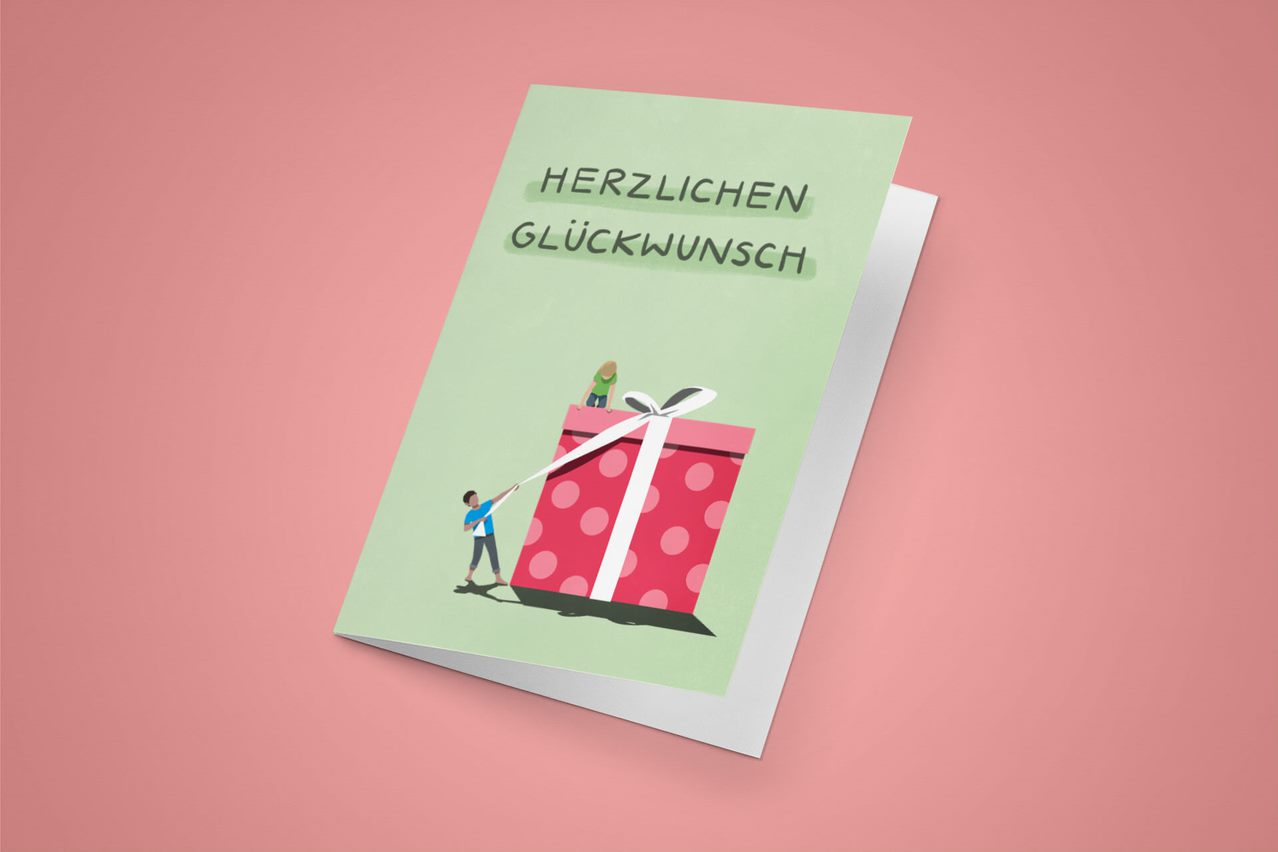Aktuelles
News, Geschichten und Ratgeber aus der Welt der SOS-Kinderdörfer
Social Media
Podcast
Climate Action – Child Protection
Die Klimakrise bedroht Menschenrechte und besonders betroffen sind junge Menschen. In der neuen englischsprachigen Podcast-Serie der SOS-Kinderdörfer weltweit sprechen Leonie Fößel und Jakob Nehls mit Gästen aus aller Welt, die sich im Kampf gegen den Klimawandel engagieren.
Mehr aktuelle Informationen

Aktuelle Hilfsprojekte
Unterstützen Sie aktuelle Hilfsprojekte. Hier finden Sie weitere Informationen zum Bau neuer SOS-Kinderdörfer, zu Entwicklungsprojekten und Nothilfeaktionen.

Presse & Medien
Pressemitteilungen, Pressefotos, Bewegtbild- und Audiomaterial, Ansprechpartner für Medienvertreter