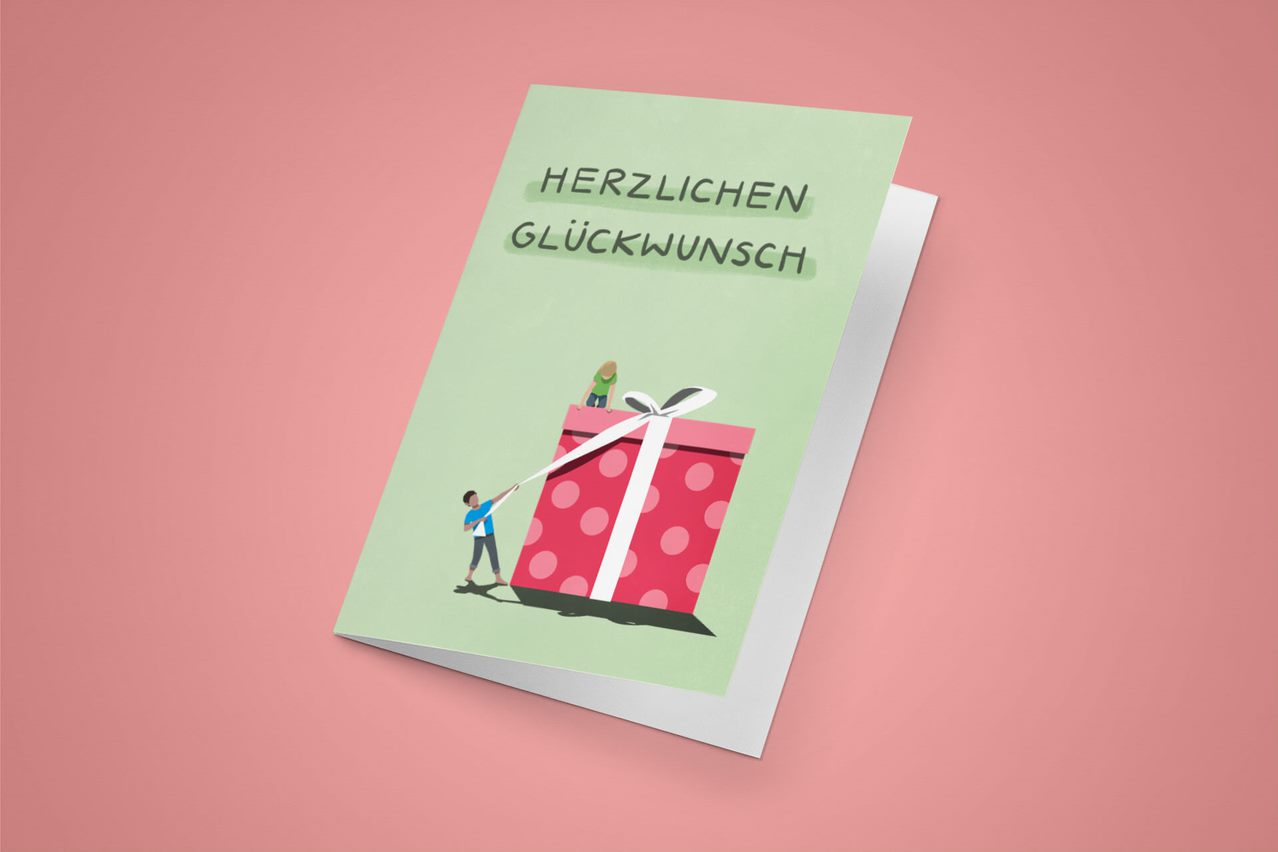Jugendarbeitslosigkeit weltweit
Der Arbeitsmarkt stagniert, die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen verbessert sich kaum. Besonders viele junge Frauen sind weder in Ausbildung, in der Schule oder in einem Job. Wer am stärksten betroffen ist und was wir dagegen tun können.
 Auszubildende im Berufsausbildungszentrum der SOS-Kinderdörfer in Bakoteh, Gambia - Foto: Philipp Hedemannn
Auszubildende im Berufsausbildungszentrum der SOS-Kinderdörfer in Bakoteh, Gambia - Foto: Philipp Hedemannn"Young working poor"
Aber auch wenn junge Menschen einen Job finden, müssen sie oft für einen Hungerlohn arbeiten ("working poor"). Im globalen Süden leben sie doppelt so häufig in extremer Armut. Nach der Definition der Weltbank heißt das: Sie haben weniger als 2,15 Dollar am Tag zur Verfügung. Auch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie im informellen Sektor tätig sind, also zum Beispiel als Tagelöhner:innen, Straßenhändler:innen oder Haushaltshilfen arbeiten, ohne Sicherheit und mit sehr geringem Einkommen.
Gender Gap: Junge Frauen besonders häufig ohne Job
Insgesamt sind junge Frauen deutlich häufiger ohne Job als junge Männer. Im Jahr 2024 waren nach Schätzungen der ILO 30 Prozent der Frauen zwischen 15 und 24 Jahren erwerbstätig, bei den jungen Männer waren es 42,7 Prozent. In Ländern mit geringem Einkommen sinkt die Erwerbsbeteiligung von jungen Frauen seit 2013 und ging auch im vergangenen Jahr weiter zurück. Auch bei den NEETs liegen die Raten bei Frauen deutlich höher als bei Männern. So waren 2024 nach Schätzungen der ILO weltweit 173,3 Millionen Frauen (28,2 Prozent) und 85,8 Millionen (13.1 Prozent) junge Männer nicht in der Schule, in einer Ausbildung oder in Arbeit.
Der Gender Gap, der sich in den letzten zwei Jahrzehnten nur geringfügig verändert hat, ist in den verschiedenen Regionen der Welt sehr unterschiedlich. Besonders groß ist er in den arabischen Staaten, aber auch in Nordafrika und in Südasien. Die Corona-Pandemie hat die Benachteiligung junger Frauen noch verstärkt. Sie waren häufig die ersten, die die Schule und ihre Ausbildung abbrechen mussten und sie waren die letzten, die zurückkehrten. In Bangladesch zum Beispiel gingen zehn Prozent aller Mädchen zwischen 12 und 15 gar nicht in die Schulen zurück, auch in Ghana, Kenia und Nigeria sind die Schulabbrecherquoten enorm hoch. Hohe NEET-Quoten bei Mädchen bedeuten in der Folge auch eine große Zahl Kinderehen, Frühschwangerschaften und Kinderarbeit.
Hohe Jugendarbeitslosigkeit gefährdet nachhaltige Entwicklung
Eigentlich wollte die Weltgemeinschaft bereits bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich verringern. Dies hatte sich die UN mit ihren nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals – SDGs) vorgenommen (Unterziel 8.6.) – ein Ziel, das also deutlich verfehlt wurde.
Langfristige Folgen
Für die Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen ist das Risiko besonders hoch, dass Rückschläge nicht aufgeholt werden können, auch dann nicht, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder ändern. Denn junge Menschen, die keinen Schulabschluss machen konnten, die eine Ausbildung abbrechen mussten oder gar nicht erst beginnen konnten, haben langfristig schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Berufsanfänger, die früh ihre Jobs verlieren, landen außerdem aus der Not heraus in Jobs, für die sie überqualifiziert sind, im Niedriglohnsektor oder gar in der Illegalität. Experten nennen diesen Langzeit-Effekt "Scarring" (Narbenbildung).
Armut, Ausgrenzung, Depressionen
Arbeitslosigkeit in jungen Jahren erhöht also das Armutsrisiko – und das lebenslänglich. Für viele der Betroffenen bedeutet dies: geringere Lebenszufriedenheit, soziale Ausgrenzung und ein schlechterer Gesundheitszustand. Studien zeigen, dass sich Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen besonders stark auf die psychische Gesundheit auswirkt. Depressionen, aber auch Drogenmissbrauch können Folgen sein.
Hoher Preis für die Gesellschaft
Die weltweit hohe Jugendarbeitslosigkeit hemmt die wirtschaftliche Entwicklung und verschärft soziale Ungleichheit. Die gesamtgesellschaftlichen Folgen sind fatal: Denn wenn die junge Generation keine Perspektiven hat, bereitet dies den Nährboden für gesellschaftliche Konflikte, politische Instabilität und Kriminalität. Weitere Folgen sind Armutsmigration und die Abwanderung von qualifizierten Arbeitskräften.

Wo die Zukunftschancen liegen
Große Potenziale sieht die ILO in der grünen und blauen Wirtschaft sowie in digitalen Technologien. Zur grünen Wirtschaft gehören der Ausbau erneuerbarer Energien, nachhaltige Landwirtschaft, Recycling, unter blauer Wirtschaft versteht man die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen. Außerdem fordert die ILO Investitionen in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Bildung. Dort könnten nicht nur sehr viele Arbeitsstellen, besonders für junge Frauen, geschaffen werden. Solche Investitionen würden auch wesentlich zur Erreichung der SDGs 3 (Gesundheit und Wohlergehen), 4 (hochwertige Bildung), 5 (Gleichstellung der Geschlechter) und 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum) beitragen.
Bildung und Ausbildung: So kämpfen die SOS-Kinderdörfer gegen Jugendarbeitslosigkeit

- Die SOS-Kinderdörfer bieten sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen Zugang zu einer fundierten Bildung und Ausbildung. Vielerorts betreiben wir eigene Bildungsreinrichtungen: Das beginnt mit der frühkindlichen Bildung in unseren Kindergärten. Unsere Schulen setzen Maßstäbe für eine qualitativ hochwertige Grund- und Sekundarbildung. Und in unseren Berufsbildungszentren bilden wir selbst aus. So befähigen wir junge Menschen, ihre Zukunft selbst zu gestalten.
- Da Mädchen nach wie vor in vielen Ländern strukturell benachteiligt sind, liegt auf Mädchenbildung ein besonderer Fokus.
- Um sozial benachteiligten Jugendlichen den Berufseinstieg zu ermöglichen, setzen die SOS-Kinderdörfer verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen. So haben wir die weltweite Jobinitiative YouthCan! gestartet. Trainings, Praktika und Coachings, die wir gemeinsam mit Unternehmenspartnern konzipieren, verbessern die Beschäftigungschancen junger Menschen. 2021 unterstützte YouthCan! 14.485 junge Menschen in 42 Ländern beim Übergang in die Arbeitswelt.
Hilfe, die wirkt: Fallstudie zur Jugendbeschäftigung
Die SOS-Kinderdörfer können die langfristige Wirkung ihrer Arbeit belegen. So zeigt eine Fallstudie zur Jugendbeschäftigung, wie erfolgreich die Familienhilfe-Programme der SOS-Kinderdörfer im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit sind. Analysiert wurden Daten zur NEET-Rate, also dem Anteil der 15 bis 24-Jährigen, die weder eine Arbeit haben, noch in Schul- oder Berufsausbildung sind. Die Studie zeigt: Die NEET-Rate in unseren Familienstärkungsprogrammen liegt beim Eintritt bei 40 Prozent – deutlich über dem globalen Durchschnitt (22 Prozent). Bis zum Ende der Unterstützung sinkt die Rate dann auf 19 Prozent – und liegt damit am Ende sogar unter dem globalen Durchschnitt.
Die Fallstudie belegt:
- Junge Menschen aus zerrütteten Familien sind beim Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt weltweit erheblich benachteiligt.
- Durch unsere Programme können wir die Beschäftigungsfähigkeit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen deutlich verbessern.
- Die gezielte Unterstützung sozial benachteiligter junger Menschen kann maßgeblich zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) beitragen.